Das Haus S. steht in einem Wohnquartier der Stadt Bern.
Es wurde 1941 für vier Erwachsene gebaut: Nämlich die Grossmutter, die Tante und die Eltern von Sabine, die damals ein junges, kinderloses Paar waren.
Seit 80er Jahren hat sich das Haus stark weiterentwickelt, doch die ursprüngliche Struktur ist nach wie vor erhalten.
Sabine und Georg sind heute die Eigentümer. Sie bewohnen das Erdgeschoss des ursprünglichen Hauses. Die einstige Garage nutzen sie als Arbeitszimmer.
Ihr Sohn Samuel, seine Frau Brigit und ihre drei Kinder wohnen im angebauten Nachbarhaus. Dieses wurde in den 1980er Jahren zwischen den beiden Nachbarhäusern erstellt.
Im ursprünglichen Haus wurden die beiden Stockwerke über der Wohnung der Eigentümer mehrfach umgebaut. Heute bewohnt die Familie V. das Duplex: Caroline, Peter und ihre drei Kinder.
Insgesamt leben zwölf Personen in diesem Gebäudeensemble, das anfänglich für vier Erwachsene geplant war.
Mit ihren Um- und Zubauten passt sich die Liegenschaft flexibel dem Lebenszyklus ihrer Bewohner an, bringt Lösungen für neue Bedürfnisse und wechselnde Haushaltsgössen.
Zwischen familiärem Rückzug und entspanntem Miteinander zieht das Haus S. seit über 80er Jahren seine Bahn!






Drei Generationen finden in diesem Haus Platz.
Die jüngste ergreift zuerst das Wort: Balz vergleicht das Haus mit Bullerbü: «Es gibt die Alten, dann die Eltern und dann uns.» (Astrid Lindgren, «Die Kinder aus Bullerbü»)
Richard geniesst die Nähe zu seinen Grosseltern und das Vergnügen, mit anderen Kindern zusammen zu sein, ohne weit weg zu müssen.
Jon hebt hervor, wie schön es ist, einen Freund direkt nebenan zu haben, während Gil manchmal die Ruhe geniesst, um in aller Stille zu lesen.
Mila und Tilly sind beste Freundinnen. Sie leben in idealer Nähe, nah genug, um ihren Alltag zu teilen, aber mit ausreichend Distanz, um ihre Unabhängigkeit zu bewahren.
Samuel, der Sohn von Sabine und Georg, den Eigentümern, erzählt: «Es ist die vierte Generation, die hier lebt. Ich finde das super, aber es ist auch so, wie ich es kenne und gewohnt bin.»






Das Haus wird 1941 von Sabines Eltern gebaut.
Ihre Eltern sind damals ein junges Paar ohne Kinder. Sie bewohnen das Haus mit der Schwester ihrer Mutter und ihrer Grossmutter. Ende der 1940er Jahre gründet das Paar eine Familie. Wenige Jahre später überlassen die Grossmutter und die Tante das Haus der jungen Familie.
Sabine erinnert sich, dass persönliche Veränderungen sich immer auch im Umbauen äusserten: «Meine Eltern bauten dieses Haus immer wieder lustvoll um.»

Ein entscheidender Umbau des Hauses fand statt, als Sabine 16 Jahre alt ist: Das Dach wird angehoben und drei Schlafzimmer mit Bad im neuen Dachgeschoss eingerichtet.
Mit einem Dach, das hinab bis zum Erdgeschoss reicht, präsentiert sich das einst bescheidene Haus neu als «modernes Architektenhaus», das im Strassenbild auffällt.
Georg betont, dass diese Etappe der 1960er Jahre den Weg für alle späteren Umnutzungen ebnete.
Im Jahr 1968 zieht Sabine nach Zürich, um zu studieren. Nach und nach finden sich ihre Eltern allein im grossen Haus wieder.
1977 kehren Sabine und Georg mit ihrem ersten Kind nach Bern zurück. Anfangs mietet die junge Familie eine Wohnung in der Nachbarschaft. In dieser Zeit wird die Nachbarvilla des Elternhauses zum Kauf angeboten. Der hohe Preis verhindert jedoch den Erwerb durch Sabine und Georg.


Sie machen einem anderen interessierten jungen Paar den Vorschlag, ihnen die Landfläche zwischen Haus und Grundstücksgrenze mit einem Anbaurecht zu verkaufen, um mit den Einnahmen den Kauf zu finanzieren.
Sabine erhält von ihren Eltern als Erbvorzug den entsprechenden Landstreifen inklusive Anbaurecht auf dem elterlichen Grundstück.
So verfügen Sabine und Georg über ein 10 Meter breites Grundstück zwischen den beiden bestehenden Häusern. Dort bauen sie Anfang der 1980er Jahre ihr eigenes Haus, das sie mit ihren beiden Kindern bewohnen.
Für Sabine ist das Leben in der Nähe ihrer Eltern kein Problem, und die Kinder geniessen es besonders.

Zu Beginn der 1990er Jahre trifft die Finanzkrise das Unternehmen ihrer Eltern, wodurch das Haus zu einer grossen Belastung wird.
Sabine und Georg bieten an, einen Teil des Elternhauses zu mieten: Sie richten dort ihr Büro ein und nutzen das Dachgeschoss als unabhängige Wohnung.
Um die Kosten zu decken, vermieteten sie ihr eigenes angrenzendes Haus an eine Wohngemeinschaft: Ihre beiden mittlerweile erwachsenen Kinder leben dort mit drei Freunden zusammen.
Obwohl aus finanziellen Gründen gewählt, erweist sich diese Lösung als sehr gesellig: «Wir haben viele schöne Feste im Garten gefeiert!»
Eine neue Aussentreppe im Hof schafft einen unabhängigen Zugang zu den Arbeits- und Wohnräumen. Im Obergeschoss wird eine Wendeltreppe installiert, um das Büro mit der Wohnung im Dachgeschoss zu verbinden.
Die aufeinanderfolgenden Umbauten verleihen dem Haus einen fast organischen Charakter: Die Wohneinheiten greifen ineinander, teilen Waschküche, Keller, Heizung und Ausgänge zum Garten: «Die Kinder nutzen diese Räume als Verstecke oder Geheimgänge.»

Nach dem Tod ihrer Eltern organisieren Sabine und Georg das Elternhaus neu, um es wirtschaftlich tragfähig zu machen.
Sie ziehen ins Erdgeschoss und richteten zwei unabhängige Wohnungen im ersten Stock und im Dachgeschoss ein.
Als Caroline und Peter in die Dreizimmerwohnung im ersten Stock einziehen, sind sie ein junges Paar ohne Kinder.
Caroline erzählt, wie sich ihre Familie im Laufe der Jahre vergrössert und ihre Wohnung mitwächst.
Das Paar und ihre drei Kinder nutzen heute beide Stockwerke und bewohnen ein Fünf-Zimmer-Duplex inklusive Arbeitszimmer für Peters selbstständige Tätigkeit.
Für die Familie stellt der Garten ein zusätzliches Zimmer dar, das alle intensiv nutzen.





Bei der Umwandlung des Hauses in drei übereinander liegende Wohneinheiten bauen Sabine und Georg die ehemalige Garage in ihr Büro um.
Es wird ein Badezimmer installiert, eine Küche könnte später eingerichtet werden. Sabine gefällt, dass die ehemalige Garage so vorbereit ist, dass sie eines Tages als kleine, unabhängige Wohnung funktionieren könnte: «Entweder, um sie zu vermieten oder selbst dort zu wohnen, falls eines von uns beiden allein wäre».
Ein Verkauf der Immobilie wurde nie in Betracht gezogen: «An so einem Standort aus wirtschaftlichen Gründen zu verkaufen, das wäre ein Irrsinn».

Die Mieteinnahmen finanzieren den aktuellen Wert der Immobilie und ermöglichen die Liegenschaft in der Familie zu halten.
Georg fasst zusammen: «Bis heute hat das so funktioniert, weil wir schrittweise und in Intervallen renoviert und immer auch überlegt haben, wie die Situation in zehn Jahren aussehen könnte».
Er betont die Bedeutung der Mieteinnahmen für die Finanzierung der Kosten: «Viele Eigentümer haben ihre Hypothek über die Jahre reduziert. Generieren sie neue Einnahmen, können sie die Hypothek auch wieder hochfahren».
Samuel erwägt, eines Tages das Mittelhaus Haus zu verlassen, um in eine der kleineren Wohnungen im Elternhaus zu ziehen.
Für ihn ist dies eine Option, keine Verpflichtung.
Er fühlt sich jedoch verantwortlich, sein Bestes zu tun, damit auch zukünftige Generationen das Haus nutzen können.
Brigit Brigit blickt in die Zukunft: «Eines der Kinder hat schon gesagt, dass es später wieder hier wohnen möchte». Obwohl verlockend, wird nicht darauf hin geplant.
Das Haus wurde in Etappen umgebaut, manchmal alle zehn Jahre, manchmal alle zwanzig Jahre. Sabine lacht: «Seit dem letzten Umbau sind 21 Jahre vergangen, also muss wohl bald wieder etwas unternommen werden».
Georg beschreibt ihre Haltung: «Wir haben lieber überlegt, was wir machen können, als Gründe zu suchen, weshalb wir nichts machen können».
Sabine ergänzt, dass die finanzielle Lage nicht immer einfach war: «Manchmal haben wir nicht gewartet, bis alles amortisiert war, bevor wir ein neues Projekt begonnen haben».
Georg bestätigt, dass sie finanzielle Risiken eingegangen sind: «Rückblickend hat es funktioniert. Wo liegt also das Problem?»
Die wirtschaftliche Tragfähigkeit war immer essenziell.
Der Spielraum war manchmal eng, und Kompromisse waren notwendig. Georg erklärt: «Kompromisse einzugehen und entspannt damit zu leben, das hat uns weitergebracht».
Die in den 1960er Jahren durch Sabines Eltern realisierte Erweiterung legte den Grundstein für die spätere Entwicklung:
«Der Dachumbau schaffte viel Raum um das Treppenhaus herum. Solche grosszügigen Räume wären in einem Neubau nicht gerechtfertigt gewesen. Uns waren sie später jedoch nützlich, um Wände zu setzen und separate Wohneinheiten abzutrennen».
Sabine betont: «Die Erschliessung ist entscheidend, um flexibel zu bleiben und verschiedene Nutzungen zu ermöglichen».
Einige Böden stammen aus dem Jahr 1941 und weisen schalltechnische Grenzen auf.
Obwohl der Schallschutz im Laufe der Renovierungsarbeiten verbessert wurde, bleibt er problematisch: Die Bewohnerinnen und Bewohner hören einander. Doch die guten Beziehungen unter den Nachbarn machen diesen Mangel erträglich.
Sabine lacht: «Da ich weiss, wer es ist und warum es laut ist, bleibe ich gelassen. Georg und ich drehen einfach den Fernseher etwas lauter».
Balz ergänzt, dass ein Nachteil in einen Vorteil verwandelt werden kann: «Wenn meine Grosseltern einen Film schauen und ich bin allein, gehe ich zu ihnen, weil ich weiss, dass sie noch wach sind».
Georg erklärt, dass die Schallisolation nie den Standard einer Eigentumswohnung erreichen wird. Wenn das Zusammenleben dennoch gut klappt, ist das zwangsläufig den Beziehungen zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern zu verdanken: «Mit Fremden würde das nicht funktionieren.» Sabine stimmt zu: «Beide Seiten würden sich ständig beschweren.»
Für das Paar liegt in jedem Haus ein Transformations- und Optimierungspotential, zumal die Qualität des Rohbaus bei Gebäuden in der Schweiz besonders hoch ist.
Doch es ist wichtig, sein Projekt gut zu planen und sich mit Architektinnen und Architekten zu umgeben, die gerne umbauen und renovieren.
Sabine nennt zwei weitere Bedingungen für den Erfolg eines Projekts: «Man darf nicht zu perfektionistisch sein. Und man muss bereit sein, aus seinen Fehlern zu lernen. Aber das hat mehr mit dem Leben als mit dem Bauen zu tun».
Das Zusammenleben basiert auf Dialog: «Wenn etwas nicht stimmt, sprechen wir es sofort an», erklärt Sabine.
Zu Jahresbeginn wird eine Sitzung anlässlich der Nebenkostenabrechnung organisiert. Für Georg ist die Verwaltung der Wohnungen kein Problem: «Wir haben keine Schwierigkeiten, wir besprechen einfach alles».
Caroline meint, dass in Abwesenheit fester Regeln Dialog, Offenheit und eine gewisse Flexibilität den Erfolg des Zusammenlebens garantieren.
Samuel fügt hinzu: «Wir fragen uns immer: Was ist am einfachsten? Was macht am meisten Sinn? Wie lösen wir das?»
Brigitte erwähnt die unkomplizierte Organisation der Pflichten: «Derjenige, der daran denkt, bringt den Müll raus, zum Beispiel. Wenn nicht, na ja, dann wird es eben vergessen.» Manche Kleinigkeiten nerven manchmal, aber Konflikte werden mit Humor gelöst.

Auch die Nutzung der Aussenbereiche funktioniert mit gegenseitigem Respekt.
Jeder Haushalt hat einen eigenen Bereich.
Aber die Grenzen sind fliessend: «Man fragt einfach einander», fasst Caroline zusammen.

Brigit schätzt die Spontanität, die sich aus dieser Flexibilität ergibt.
Sie fügt hinzu: «Alle müssen offen genug sein, sich nicht beobachtet zu fühlen, sonst funktioniert das nicht».
Samuel stellt jedoch klar, dass sich jeder zurückziehen kann, wann immer er möchte: «Wir leben in ineinander verschachtelten Häusern, nicht auf einem Festival!»












Caroline hebt den Reichtum dieses gemeinschaftlichen Lebens hervor, auch für die Kinder: «Was gibt es Besseres? Als Kind wäre das mein Traum gewesen!»
Samuel ist seinen Eltern dankbar für ihre Unterstützung, insbesondere für ihr Engagement für die Kinder. Er möchte sie im Alter ebenfalls unterstützen: «Solange meine Eltern da sind, bin ich auch da, das ist sicher.»
Für Sabine und Georg ist das Wichtigste: «Was am meisten zählt, ist, dass wir hier nicht allein sind». Sie beschreiben das Haus als eine Art Biotop, in dem jeder zu irgendeinem Zeitpunkt Unterstützung oder einen Moment des Austauschs findet.
Für Balz ist die Schlussfolgerung klar: «Ich würde sagen, besser kann man eigentlich gar nicht wohnen!»
Partnerschaften
Dieser Bereich richtet sich an Gemeinden, Kommunen, Bewohnerinnen und Bewohner, die aktiv an der Transformation ihrer EFH-Siedlung(en) teilnehmen möchten. Nur in französischer Sprache verfügbar.
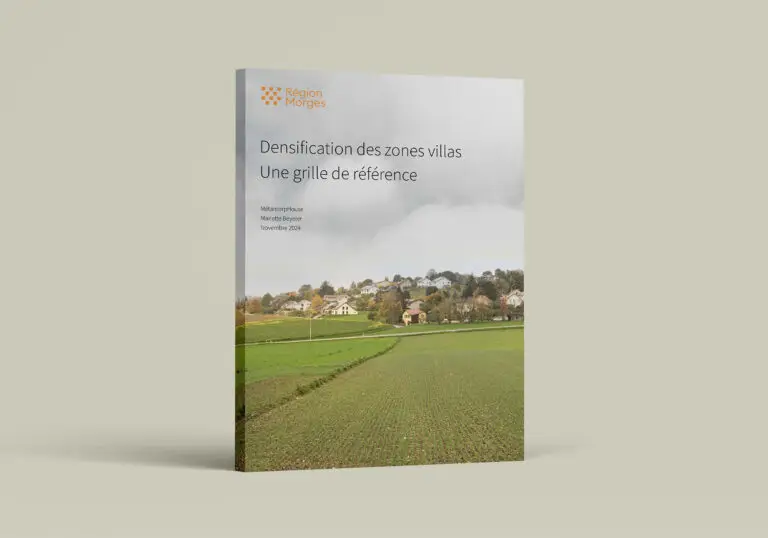
Der Bericht « Densification des zones villas. Une grille de référence », der für die Region Morges erstellt wurde, ist kostenlos im PDF-Format verfügbar.
Bitte füllen Sie das Antragsformular aus, um den Link zum Download zu erhalten.
Cette section s’adresse aux propriétaires d’une maison individuelle qui souhaitent la rénover/transformer pour l’adapter à leurs besoins.
Cette page thématique est en préparation, repassez nous voir dans quelques temps !